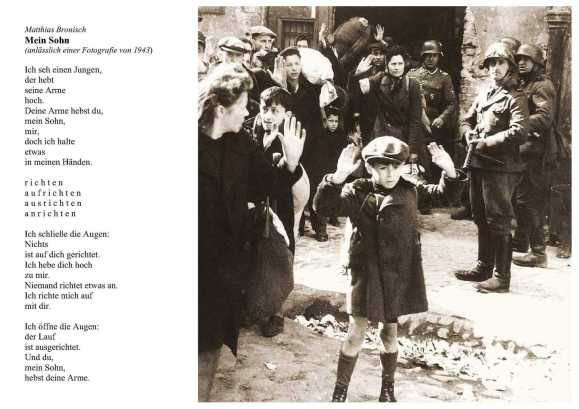Hier finden Sie uns
Reichenberger Str. 22d
33605 Bielefeld
homepage: matthias-bronisch.de
Kontakt
Willkommen auf meiner homepage!
Ich freue mich, Sie auf meiner Homepage begrüßen zu können. Informieren Sie sich auf meiner Internetpräsenz über literarische Neuerscheinungen, die Literaturzeitschrift aus OWL "Tentakel", den Wettbewerb "Jugend schreibt", neue Bilder und Texte und die Familie Bronisch
Überarbeitet: 20. Februar 2024
Bei St.Peter-Ording, Aquarell
Krüge vom Balkan, Aquarell
Einfühlung und Abstraktion in der Kunst Ernst Lindemanns
Kaum eine Dissertation in der Kunstgeschichte hat soviel Diskussionen ausgelöst wie „Abstraktion und Einfühlung“ (1905) von Wilhelm Worringer. Sein neuer Blickwinkel auf die Entstehung von Kunst, auf den Umgang des Künstlers mit der ihn umgebenden Welt, hilft beim Verständnis der Kunst.
Die abendländische Kunst ist bestimmt von einem Einfühlen in die Welt, die den Künstler umgibt, er liebt diese Welt, sie gibt ihm Maß und Raum. Da ist keine Flucht vor dem Unbeherrschbaren, da schrecken nicht Donner und Blitz, da tritt der Mensch nicht die Flucht in die Glückseligkeit des Jenseits an. Die griechischen Götter sind menschlich, sind in den Räumen, in denen auch der Mensch lebt, zu Hause. Das bleibt nicht so. Im Mittelalter unter der christlichen Religion bedeutet der Glaube wieder Erlösung von irdischer Beschwernis, aus dem Jammertal. In dieser Zeit kommt es zu stärkerer Abstraktion. In der Gotik, vor allem in der gotischen Architektur, ist eine Jenseitsflucht bestimmend.
Doch mit der Renaissance wendet sich der Künstler und natürlich wenden mit ihm die Menschen sich dem Diesseits zu, der Mensch entdeckt wieder sein Ich und er entdeckt die Welt, in der er Gott nun zu finden meint. Mit der Hinwendung zur Welt entsteht das Landschaftsbild, das sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte zum bestimmenden Thema entwickelt, bis es seinen Höhepunkt im Impressionismus erreicht.
Hier setzt die Malerei Ernst Lindemanns ein. Er, der durch ein traumatisches Erlebnis zu Beginn seiner Jugend, aus der Bahn geworfen wurde, entscheidet sich für den künstlerischen Weg, der oft auch Einsamkeit bedeutet. Er wählt den Brotberuf der angewandten Kunst, aber in seiner Lebensbeschreibung nennt er sein künstlerisches Schaffen sein Eigentliches. Doch zu Anfang spielt er die künstlerischen Wege seiner Zeit nach, den Impressionismus, den Jugendstil, ehe er zu dem kräftigeren Zugriff des Expressionismus kommt. Während er in seiner Ausbildung auch immer wieder Portraitzeichnungen gemacht hat, ist der Mensch als Gegenstand seiner Kunst selten, nämlich nur als Selbstportrait. Er ist ganz auf die Landschaft konzentriert, nicht die liebliche der Impressionisten, die leuchtende, sonnige, die blumenbewachsenen Wiesen unter blauem Himmel und leichten weißen Wolken, sondern seine Landschaften sind schwer, oft finster, der Mensch ist nur mit seinen heftigen Eingriffen da oder in den geduckten Hütten. Er selbst ist nicht zu sehen. Warum löst sich Ernst Lindemann so völlig von dem breiten Themenspektrum der Malerkollegen seiner Zeit? Van Gogh, Munch, Nolde, die er in Hamburg sieht, malen auch die Menschen. Er aber fühlt sich in die Landschaft ein, sie allein ist Raum, in dem er sich spüren kann. Ja, er hat den Turm der Johannis-Kirche gemalt, auch Dachgiebel, aber eben keine Stadt mit Menschen, mit Verkehr mit dem Gewirr der Straßen. Für ihn war die Landschaft sein Part, oder sollte man sagen Widerpart? Zu Anfang fühlt er sich noch ein, da sind auch Blumenrabatten, gemähte Felder mit Hocken. Aber die Bilder werden immer bewegter, immer heftiger die Farben, und er gerät tiefer in die Abstraktion, bis schließlich nur Bewegung, Heftigkeit des Farbauftrags und Linienschwung bleiben. Was führt bei Ernst Lindemann zu dieser Abstraktion? Worringer hat die Abstraktion als Kunstform damit erklärt, dass der Mensch sich dem Raum gegenüber, in dem er lebt, verloren fühlt, dass er ihn als Bedrohung sieht, dass er ihn bannen muss in Zeichen, eben in abstrakten Zeichen, die überschaubar und klar sind. Ernst Lindemann schreibt in seinem Aufsatz „Vom Sinn unserer Landschaft“:
„Nicht nur um uns ist unsere nordwestliche Landschaft, sondern auch in uns. Auf Gedeih und Verderb gehören wir zu ihr. Nicht sie kommt zu uns, sondern wir müssen zu ihr kommen. Weil wir ja nur in ihrer Luft ganz tief atmen können. In dieser Luft, die ungehindert über Felder und Wälder weht, über Heide, Moor und Meer. Leise ist dies Wehen manchmal und dann wieder wird es zum peitschenden Sturm. Wolken rasen, ihre Schatten gespenstern über das weite Land; ein tosendes Miteinander von sprühendem Licht und abgründigem Dunkel, worin alles Dinghafte versinkt. Nach dem Drama wieder die Stille. Helles und Dunkles kämpft nicht mehr, sondern sein Strömen, Wogen will Einheit werden, ein einziges großes, lebendes, atmendes Wesen.“ Etwas weiter heißt es: „. Auch er (der Mensch) neigt sich in erschauernder Ehrfurcht; auch er weiß, dass er hier klein, gering ist, einem Sandkorn gleich, das der Wind wirbelnd entführt.“ (Ernst Lindemann, Vom Sinn unserer Landschaft; in: Lüneburgsche Anzeigen, 3. Blatt.5 Gilbhart/ Oktober 1934)
Die Sprache verrät schon zu Anfang dieses Textes, worum es geht: Gedeih und Verderb, peitschenden Sturm, Schatten gespenstern, abgründigem Dunkel. Seine Behinderung hat ihn den Menschen vielleicht entfremdet. Und die Landschaft? Auch sie hat etwas Bedrohliches, etwas, was den Menschen auszuschließen scheint. Aber Ernst Lindemann kämpft um diese Landschaft, wenigstens zu ihr möchte er gehören, in ihr möchte er zu Hause sein. Bleibt ihm am Ende nur, sie in Zeichen zu bannen? Über weite Strecken hat Ernst Lindemann sich eingefühlt in die Landschaft, sie hat er als seinen Raum erlebt. Doch hat er nicht den Menschen in diesem Raum gesehen. Versteckt, geduckt sind seine Behausungen in der Landschaft versteckt. War es seine Behinderung, die ihn den Menschen entfremdet hat? War es die Landschaft, die ihn nach Halt suchen ließ? War er ein Unbehauster, der nach der Landschaft als dem Zuhause suchte?
Wie er zu Anfang seines Textes beschreibt, scheint sie ihn auszustoßen, sie ist ein ‚abgründiges Dunkel’. So ist vielleicht zu verstehen, dass er zu abstrakteren, ornamentalen Formen kommt, in denen er die Landschaft zu bannen versucht. Worringer versucht die nordeuropäische Entwicklung zu erklären: „Und da ergibt sich ja schon …. die Tatsache, dass in dieser Kunst die Tendenz in ihrem ganzen Anfange eine abstrakte ist, die dem Organischen als Trübung des Ewigkeitswertes möglichst auszuweichen sucht und die wieder mit aller bewusster Absicht die Dreidimensionalität vermeidet und alles Heil in der Fläche sucht.“ (Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, München 1959, S.143)
So sieht man im oberen Bild wie der Künstler sich einfühlt in das Organische: Blumen, dahinter aufragende Bäume und im Durchblick eine Kirchenwand. Die Welt ist im Stil des Impressionismus erfasst. Das untere Bild drückt die Landschaft in die Fläche, ins Ornamentale. Bannt sie geradezu ins Zeichenhafte, um sich ihr nicht im Einfühlen auszuliefern.
Die beiden Begriffe entsprechen nach Meinung Worringers auf dem Gebiete der Religions- und Weltanschauungsgeschichte „ der Innerweltlichkeit (Immanenz), die sich als Polytheismus oder als Pantheismus charakterisiert und der Überweltlichkeit (Transzendenz), die zum Monotheismus überleitet.“ (a,a.O., S. 143)
Im oberen Bild sind Mensch und Welt im Einklang, während im unteren Bild Mensch und Welt sich entfremdet haben. Kunst wird zum Zeichen, in dem das Strömende, Unfeste, Unstete der Erscheinung gefestigt, gebannt wird. Wenn das einfühlende Sehen den Wind in der Bewegung der Bäume wahrnimmt, in dem Ziehen der Wolken, die Bewegung des Wassers in den Schaumkronen und das wandernde Licht im Schatten wahrnimmt, dann nimmt das abstrahierende Sehen den Schwung und die Bewegung nur noch in der Führung der Linien, die verschiedenen Farben der Landschaft nur noch in einer symbolischen Farbigkeit wahr, nicht mehr in der Gegenstandsfarbe.
Geriet Lindemann in den 30er Jahren in eine Entfremdung zu seiner Zeit, er galt als entartet, und suchte er daher die Rettung in der Abstraktion? Ist vielleicht die moderne abstrakte Kunst erklärbar als Vertrauensverlust gegenüber einer Welt, die im 20. Jahrhundert aus den Fugen geraten war, und dass damit ein einfühlendes Sehen nicht mehr möglich war? Abstraktion fand im Norden statt, während in Italien und Spanien, selbst noch in Frankreich die Gegenständlichkeit in der Kunst zum großen Teil immer noch erhalten geblieben war.
(Dieser Text mit weiteren Bildern auch in der neuen Tentakel - Januar 2021)
Kindheit und Alter, Fotage 2017
Sithonia, Blick auf den Athos, Aquarell
Die große schwarze Tasche
Wir sind gern bei dir. Der Tisch ist noch ein Tisch von einem Tischler, fest und massiv. Darauf liegt die Spitzendecke, durch die das dunkel gebeizte Holz schimmert.
In der Mitte steht die Kuchenplatte mit dem duftenden Pflaumenkuchen und daneben die schwere blauweiße Kanne mit dem Kaffee.
Das aber ist es nicht, weshalb wir gerne bei dir sind.
Du sitzt da, gerade, immer ein wenig lächelnd ‑ fast immer ‑, auf deinem Schoß hast du die große schwarze Tasche.
Dein Zimmer ist ein ruhiges Zimmer, in das seltsamerweise stets die Sonne scheint. Und immer stehen Kätzchen in einer Vase auf dem Fernseher.
Aber auch das ist es nicht, weshalb wir gerne bei dir sind.
Manchmal wird es laut. Wir sind jung und streiten uns heftig. Doch du bleibst still. Und wenn dein Lächeln aus den Augen verschwindet und deine Lippen ein wenig schmaler werden, dann öffnest du die Tasche, holst ein kleines weißes Taschentuch heraus, wischt kurz über deinen Mund, und wieder lächeln deine Augen. Deine Hand hält das Tuch einige Zeit, dann knüllen die Finger es zusammen und du versenkst es in die große schwarze Tasche. ‑
Und auch wir beruhigen uns.
Ich sehe die große schwarze Tasche, und habe das Gefühl, als sei sie in den Jahren immer größer geworden.
Ober wirst du mit den Jahren kleiner?
Und ich sehe das kleine Spitzentaschentuch, von feiner netzartiger Spitze.
Im Wasser, Holzschnitt
http://www.fabelhafte-buecher.de/buecher/autoren-und-schriftsteller/matthias-bronisch/
Interview mit "fabelhafte-bücher.de"
Weiden, Radierung 2005
Was aber bleibt?
Die Hügel
von Bormes
sind nur noch
steinig.
Den Hyèren
kam jeder Mythos
abhanden.
Der Blick
ins Tal von Lavandou
ist verschwommen.
Den Wein
habe ich gegen
den Pernot
getauscht
na und? -
Zu sprechen
ist darüber so wenig
wie über
Oleander und Mimosen.
Und schon gar nicht:
eine Kerze stiften!
Ihre Flamme
verlöscht
im Sand
Zwiegespräch zu dritt
Ein Anruf hatte genügt, natürlich hatte ich zugesagt, und wenige Stunden später stand sie vor der Tür.
Doch bevor ich zusagte, mischte sie sich ein, wollte zu bedenken geben, beanspruchte ihren Platz, wandte ein, daß ich doch genug mit dem Haushalt zu tun hätte, da nun kaum noch Hilfe zur Verfügung sei. Aber ich hörte weg, schob die Argumente beiseite. Ich wagte dann sogar, offen zu widersprechen, erinnerte sie an die Gastfreundschaft, die wir während vieler Jahre auf dem Balkan erlebt hatten. `Irgendwann muß man das zurückgeben. Es ist doch Platz genug, die Kinder sind aus dem Haus. Wo ist das Problem?´ Sie sah mich an und lächelte nur. Ihr Lächeln schmerzte.
“Ja, ist gut”, sagte ich, “schicken Sie sie her. Ich habe Platz.” Ich weiß, was sie sagen wollte: daß ich nie nein sagen könne.
Sie stand vor der Tür. Sie war verlegen. Warum eigentlich, niemand wird ihr gesagt haben, wie kompliziert ihre Unterbringung war. Ich versuchte locker zu sein, bat sie herein, nahm den Koffer, stellte ihn im Flur ab und bat sie ins Wohnzimmer. “Einen Kaffee?” “Ja, gerne.” Sie sprach mit jenem Akzent, der der deutschen Sprache so gut tat, sie leicht und singend machte, wie sie es schon in der Panonischen Ebene gehört hatten -”Ist gefällig?” Und selbst die Fehler klangen schön und fügten sich so selbstverständlich in die Melodie, daß sie keine Fehler mehr waren, sondern ihre eigene Richtigkeit hatten. Auch wenn sie ihn später bat, sie zu korrigieren, er brachte es nicht übers Herz, weil er fürchtete, die Sprache würde dann erst falsch und täte weh. Es war eine neue Sprache, nicht die, die er gewohnt war, und auch er konnte neu anfangen, sich auf dieses eher heitere Spiel einlassen.
Er zeigte ihr das Gästezimmer, das Badezimmer, und sie richtete sich ein. Er ging in sein Arbeitszimmer. Wieder sah er vor sich ihr lächelndes Gesicht, fast ein wenig spöttisch. Er fühlte sich ertappt. Das war immer ihr Streitpunkt gewesen, daß er sich breitschlagen ließ, auch wenn er lieber einmal nein gesagt hätte. Sie wußte das. Manchmal hatte sie ihm geholfen und für ihn nein gesagt. Sie hatte ihn mit einer Besorgung weggeschickt und allein eine unangenehme Sache abgewendet. Viele Worte hatte sie dann nicht gemacht, der Kelch war vorübergegangen, der nächste allerdings schon unterwegs.
Sie lächelte. Er hätte ihr dieses Lächeln gerne verboten. Aber er wußte, daß sie recht hatte. Nur diesmal nicht, nein diesmal hatte sie ganz und gar nicht recht. Sie durfte ihm diese Gastfreundschaft nicht untersagen. Aber sie wehrte sich, stumm, aber eindeutig, und er schien wehrlos. Er versuchte zu argumentieren, immer mit den gleichen Gründen. `Wir haben Gutes erfahren, bitte, jetzt möchte ich auch die Fremde für jemanden erträglich machen. Sie ist für kurze Zeit als Gast hier, in unserem Betrieb. Also?´
Sie kam herein, ein braves, etwas zu braves Kostüm, nicht geschminkt, fast ein wenig linkisch. Oder unsicher? “Möchten Sie Abendbrot essen? Ich will mir auch gerade etwas machen.” “Ja, gerne, nicht mit Mühen.” Er deckte schnell den Tisch, Sets, Brettchen, Brot, Aufschnitt. Setzte Wasser für eine Brühe auf. Er fragte nach ihrem Land, was sie genau dort mache, was sie hier erwarte. “Ich bin das erste Mal in Deutschland. Es gibt sicher viel zu sehen, was kenne ich nicht.”
Er bot ihr an, an dem zweiten Schreibtisch zu arbeiten. So saßen sie sich gegenüber. Sie holte Bücher, blätterte, stellte sie zurück, entdeckte Kunstbände, betrachtete ausdauernd die Abbildungen. “Haben Sie diese Bilder gesehen?” und sie zeigte ihm Bilder von van Gogh und Cézanne. Ja, wir hatten einige dieser Bilder gesehen. Sie kannte sie nur aus Büchern, nichts hatte sie im Original gesehen. Er versuchte sich in ihre Lage zu versetzen, die Selbstverständlichkeit seines Lebens in Frage zu stellen, die unangenehme Überlegenheit beiseitezuschieben, aber wenn er sie ansah, war nichts unangenehm, sie freute sich über alles, nahm es so, wie es war, und ließ es ihn auch so sehen. Doch er wollte ihr etwas zeigen, sie sehen lassen, was so nah lag und jetzt möglich war.
Und wieder trat sie dazwischen. Ich wußte, was kommen würde. Ich könne die Welt nicht retten, ich könne nicht wieder gutmachen, was Menschen durch eine unglückliche Geschichte an Unrecht zugefügt worden war. Retten? Wen retten? Dies Gegenüber sah nicht aus, als müßte ich sie retten, dann schon eher mich, vielleicht auch aus der neuen, nicht erträglichen Einsamkeit meines Lebens und aus einem Zwiegespräch, das keines mehr war und nie wieder eines werden konnte. Diese Frau war konkret, war da und zeigte ihren Durst und Hunger. Sie lächelte nur, wie sie nun seit drei Jahren lächelte. Vielleicht wußte sie, wie verführerisch die Hilflosigkeit ist. Sie hatte mich zu lange gekannt, zu gut, sie wußte, daß gemeinsame Interessen eine Gemeinsamkeit sind. Wir hatten es erfahren.
Wir fuhren nach Holland. Wir gingen durch die Säle, wir sahen das “Café von Arles”, den “Kirschbaum” und bewunderten Marinis “Pferd”. Wir schlenderten durch den Park und durch die Gassen von Otterloo und Appeldorn. Wir sprachen über Jonescu und Iliade und über Goljadkin. Ich zündete das Feuer im Kamin an, wir hörten die Musik von Zamfir, und ich hörte ihre Stimme nicht mehr. Aber ihr Lächeln blieb. Es war nicht mehr spöttisch, es war sehr leise und freundlich geworden. Es war da, und ich ertrug es, ich wollte es sehen und für mich gewinnen, ich wollte sein Einverständnis.
Ich lächelte ihr zu, und sie lächelte zurück, fern und unauslöschlich. Ich lächelte ihr zu und sie kam und umarmte mich.
Matthias Bronisch
Vergessen
So vieles vergessen
oft ganz besessen
mich zu erinnern
und doch vergessen
Dann kommt das Erinnern
mit einem Wimmern
wenn durch ein Fenster
nachts die Gespenster
die Träume durcheilen
mich hetzen auf Wegen
völlig entlegen
von meinen Orten
ich ringe nach Worten
den Weg zu erfragen
In solchen Nächten
und den folgenden Tagen
jagen Gedanken
nach Erinnerungsfetzen
hetzen durch Zeiten
die längst vergangen
durchmessen Gefilde
die dem Vergessen
in Not übergeben
Doch aus dem Innern
steigt dann das Wimmern
wenn Erinnrung erwacht
im Traum in der Nacht